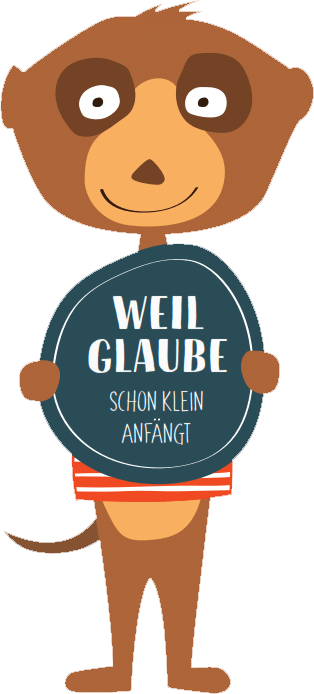Warum Langeweile für unsere Kinder wichtig ist
Alle Eltern haben ihn schon einmal gehört. Den Satz, der wie zu lange gekautes, zähes Kaugummi klingt: „Mir ist laaangweilig.“ Was kann ich tun, wenn mein Kind mir immer wieder an den Beinen hängt und scheinbar nichts mit sich anfangen kann?
Warum sich quälen? Langweile ist doch eigentlich wunderbar, oder? Als Eltern würden wir uns diesen Zustand manchmal herbeiwünschen. Doch das Kind empfindet eine unangenehme innere Unruhe. Dieser innere Zustand kann auch als ein Austarieren zwischen Konsumieren von externen Reizen und dem eigenen kreativen Ideenreichtum betrachtet werden.
Anregung von Außen
Wenn Kinder es gewohnt sind, im Kindergarten, von älteren Geschwistern oder den Eltern beschäftigt zu werden, dann fehlt ihnen im Zustand der Langeweile genau diese externe Anregung. Doch wie wichtig für die kindliche Entwicklung sind Zeiten ohne Input von Außen, in denen das Kind eigene Ideen entwickeln kann. Gönnen wir unserem Kind diese Zeiten, wo es Gebrauch machen kann vom eigenen schlauen Köpfchen und zu selbstwert-stärkenden Erlebnissen kommen kann. Wie gut fühlt es sich an zu sagen: „Das habe ich allein gemacht!“
Schweigend dazusetzen
Halten wir Momente der Langeweile einfach einmal aus, ohne unser Kind mit unseren Ideenkatalogen einzuwickeln. Schließlich wollen wir keine Konsumenten heranziehen, die sich durch ihre eigene Langweiligkeit langweilen. Vielmehr wünschen wir uns Kinder mit kreativen Köpfen, die lernen zu agieren – anstatt immer nur zu reagieren. Halten wir die Momente aus, setzen uns schweigend dazu und schauen, was die kleinen Leute für sich entdecken.
Langweilen wir uns mal gemeinsam. Dabei kann es auch passieren, dass wir plötzlich über Dinge sprechen und uns gegenseitig erzählen, die nur auftauchen, wenn der Unterhaltungsmodus eben mal ausgeschaltet ist und die innere Unruhe überwunden.
Ihre Johanna Walter