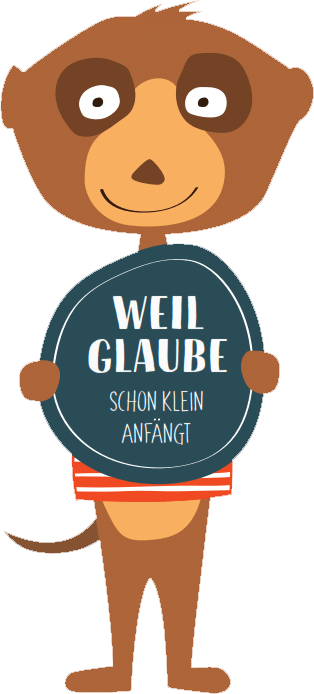„Mama, du bist du früh!“
Wer sein Kind vom Kindergarten abholt, hat vielleicht schon erlebt, dass der Nachwuchs nicht mitkommen, sondern lieber weiterspielen wollte. „Mama, du bist zu früh!“ oder ein protestierendes „Ich will noch nicht nach Hause!“ sind dann zu hören. Manche Kinder brechen auch zusammen und weinen und bekommen vor Emotionen kein Wort heraus. Was auch immer in diesem Moment in dir als Elternteil vorgeht, lass dir eins gesagt sein: Diese Reaktionen sind normal. Ich erlebe es täglich und kann dir sagen, dass es vielen Eltern so geht.
Lass uns gemeinsam beleuchten, was beim Abholen aus der Kita passiert und was du beachten kannst, damit der Abschied aus der Betreuung zufriedenstellend für alle Beteiligten wird.
Was geht in dem Kind vor?
Dein Kind hat einige Stunden in der Kita verbracht. Es hat sich an Regeln gehalten, Konflikte gelöst, mit verschiedensten Menschen gesprochen, kooperiert und alles in allem viel erlebt.
Gerade hat es sich einer Tätigkeit gewidmet, als du in die Tür kommst. Es ist mitten in seinem Tun. Das, was dein Kind im Gegensatz zu dir noch nicht kann, ist, sich schnell auf eine neue Situation einzustellen. Kitakinder haben noch kein ausgeprägtes Zeitgefühl und reagieren hin und wieder mit für uns unpassend wirkenden Reaktionen.
Es gibt ein Paar Kniffe, die das Abholen aus der Kita angenehmer gestalten können:
1. Sorge für dich und deine Bedürfnisse!
Du bist gestresst und in Eile? Sorge für einen Moment zum Durchatmen vor der Kita. Du bist hungrig? Sorge für einen Snack im Auto. Es macht einen großen Unterschied und sorgt für mehr Geduld.
2. Tauche in das Tun deines Kindes ein!
„Was machst du denn da?“, „Das sieht aber bunt aus!“, „Da hast du dir aber Mühe gegeben“, „Wie hast du es geschafft, einen so hohen Turm zu bauen?“ – mit solchen Sätzen fühlt sich dein Kind gesehen und in seinem Tun wertgeschätzt. Erfahrungsgemäß lässt sich ein Kind mit dieser Haltung schneller aus seinem Spiel herausholen als mit rationalen Argumenten oder dem Versprechen einer Belohnung zu Hause.
3. Berücksichtige die Bedürfnisse deines Kindes und bleibe gleichzeitig bei deinem Plan!
Es geht nicht darum, mehr Zeit für das Abholen des Kindes einzuplanen, sondern um einen sanften Übergang. Es darf seine Tätigkeit in Ruhe zu beenden – mit deiner Hilfe. Wenn du möchtest, auf spielerische Art. Vielleicht hilft eine Vereinbarung: „Noch einmal Farbe nachnehmen“. Überlege, wo sein Kunstwerk platziert werden kann, sodass es dies morgen wiederfindet. Bleibe klar und bewege es zum Gehen. Ist es heute an der Zeit, ihm beim Händewaschen und anziehen zu helfen, obwohl es dein Kind schon kann?
Wenn du merkst, dass dein Kind missmutig ist und nicht mitmöchte, beziehe es nicht auf dich.
Es liegt nicht an dir. Es war gerade in sein Spiel vertieft. Du darfst den Übergang liebevoll begleiten.
Pia Tober ist Erzieherin mit Leidenschaft und beschäftigt sich auch nach ihrem Feierabend mit den Themen von Kindern und ihren Familien.
Der Text ist zuerst in der Zeitschrift Family erschienen.